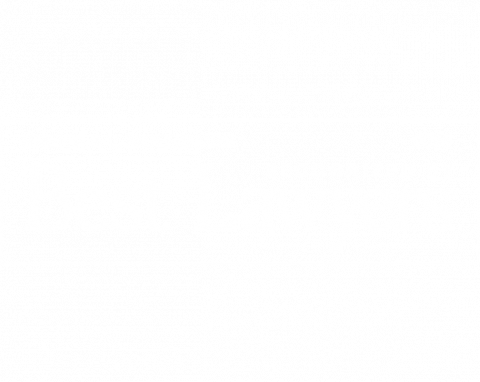Phishing-Websites sind äußerst unangenehme Erscheinungen: Es sind Nachahmungen von Internetauftritten vertrauenswürdiger Firmen oder Institutionen. Sie dienen dazu, bei Besuchern Zahlungs- oder Login-Daten „abzufischen“, die dann zu Betrugs- oder Kontoplünderungszwecken missbraucht werden.
Auch bei Google-Recherchen werden oft Ergebnisse angezeigt, die nicht zur tatsächlich gesuchten, sondern zu gefälschten Webseiten führen. Das schädigt nicht nur die User, sondern auch die Anbieter der "Original"- Seiten, deren Kunden getäuscht werden. Die Anbieter solcher Phishing-Websites wird man in diesen Fällen selten greifen können. Aber wie sieht es eigentlich mit Google aus? Google hat schließlich irgendwie mitgeholfen, den User auf die Phishing-Websites zu führen.
Genau diesen Fall hatte aktuell das Landgericht Düsseldorf zu entscheiden: Auf einem Online-Markplatz namens "Skinport" wurden mit großem Erfolg Skins für das Computerspiel "Counter-Strike" angeboten. Dieser Erfolg zog allerdings auch Kriminelle an: Sie bauten die Landing-Page von „Skinport“ nach und bewarben sie mit einem Google-Ad, das sie (ebenfalls unter falschem Namen) bei Google einstellten.
Das flog auf und Skinport informierte Google über den Mißbrauch. Google reagierte und stoppte das Google-Ad, also die eine, konkret angegriffene Werbung. Die Fälscher änderten daraufhin ihre Kundennamen und bewarben die gefälschte Skinport-Landing-Page erneut und mit immer wieder neuen Fake-Google-Ads, was Google nicht verhinderte.
Skinport verklagte nun Google unter dem Gesichtspunkt einer (Unions-) Markenverletzung und zwar wegen Mitwirkung an den betrügerischen Machenschaften der Google-Werbekunden. Google verteidigte sich damit, dass Google ja nur ein Hosting-Dienstleister sei und nicht wissen könne, welche ihrer Kunden auf gefälschte Webseiten verlinkten.
Das LG Düsseldorf urteilte salomonisch: Es gab zwar Google darin recht, dass es an der Markenverletzung nicht mitgewirkt habe. Das Gericht wandte aber die Grundsätze der deutschen Störerhaftung an: Danach kann jeder auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, der bestimmte Prüfpflichten verletzt. Google treffe ab Kenntniserlangung insoweit die Pflicht, nicht nur die konkret beanstandete Werbeanzeige zu löschen. Das Unternehmen müsse vielmehr auch nach allen „kerngleichen“ Verletzungen forschen, also nach anderen Anzeigen von Google-Werbekunden, die ebenfalls zu der gefälschten Landing-Page führen. Der Umstand, dass die Betreiber der Phishingseiten das Google-System durch Identitätswechsel ausgenutzt hätten, könne nicht zulasten von Skinport gehen. Umgekehrt sei Google nicht verpflichtet das gesamte Internet zu durchsuchen, sondern lediglich die Websites seiner Werbekunden.
Konsequenz: Google muss künftig seine Kunden wesentlich intensiver überwachen. Jedenfalls dann, wenn eine initiale Rechtsverletzung mitgeteilt wird, muss Google die Angebote der eigenen Werbe-Kunden auf „kerngleiche“ Rechtsverstöße hin untersuchen. Google wird also künftig nach Phishing fischen.
Für Juristen: Das Urteil ist weiteres Kapitel im umstrittenen deutschen Sonderweg der sog. Störerhaftung. Sie soll nach dem Urteil jetzt auch im Bereich der Unionsmarkenverordnung gelten und zudem nicht im Widerspruch zu den Privilegierungsvorschriften für Hosting-Anbieter stehen (vgl. Art. 6 Digital Services Act). Beides wird im Urteil näher begründet.
https://www.juris.de/static/infodienst/autoren/D_NJRE001599423.htm